Viele sind bereit, viel Geld für einen perfekt passenden Sattel auszugeben. Sie vermessen ihr Pferd, probieren zig Modelle und lassen sich von Händlern, Reitlehrern und Osteopathen beraten. Trotzdem beklagen sie sich anschließend über mangelhafte Paßform.
Schuld an der Misere haben Käufer, Händler und Sattelfirmen gleichermaßen, weil sie in einem Kreislauf aus gegenseitigen Abhängigkeiten und unerfüllbaren Wünschen stecken. "Die Leute reiten immer schlechter und geben oft zu Unrecht dem Sattel schuld am Satteldruck", sagt Frank Wohlhorn, vereidigter Sachverständiger und verantwortlich für die Prüfung der FN-Fachberater.
"Dazu kommen immer wieder Händler, die zu wenig Ahnung von der Anatomie haben und schlecht beraten. Und nicht alle Hersteller verkaufen gute Produkte."
Dabei sind die meisten Sättel besser als ihr Ruf. Viele große Sattelfirmen bauen auf ihre Tradition. Sie verkaufen seit 30, 40 Jahren kaum veränderte Sattelbaummodelle. So werden die Stahlfederbäume der Firma Joh’s Stübben KG mit minimalen Veränderungen seit den 50er Jahren hergestellt.
Auch G. Passier & Sohn baut seinen PS-Baum (für den nach eigenen Angaben 1200 Arbeitsschritte notwendig sind) seit den späten 50er Jahren. Fast eine Neuheit ist dagegen der Kunststoffbaum der Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik, der seit 27 Jahren produziert wird.
Die bewährten Sattelbäume sind nicht schlecht. Doch seit zwei, drei Jahrzehnten gibt es immer mehr Pferde mit schwieriger Sattellage, weil die Zucht heute schmalere Pferde produziert.
Waren früher breitere Sättel gefragt, verkaufen sich heute schmalere Sättel mit einer kleinen Kammerweite besser. Darauf haben sich aber noch nicht alle Hersteller eingestellt. Zu wenige bieten sehr schmale Sättelbäume mit kleiner Kammerweite an (etwa Stübben mit 15 Zoll Kammerweite).
Die Crux daran ist, daß der Kunde kaum erkennen kann, was schmal und breit, lang und kurz ist. Schuld daran sind fehlende Vergleichsmaßstäbe und die uneinheitliche Größeneinteilung der Hersteller.
Kammerweite und Sattelgrößen

Die meisten Hersteller geben die Sitzgröße in Zoll an. Sie beträgt in der Regel zwischen 16,5 Zoll (36 Zentimeter) für kleine und 18 Zoll (42 Zentimeter) für große Gesäße.
Die Sitzgröße gibt Auskunft, wieviel Platz das Gesäß im Sattel hat. Meistens wird vom Sattelknopf bis zur Mitte des Efters, also dem hintersten Punkt der Sitzfläche (Hinterzwiesel), gemessen.
Es gibt aber auch Hersteller, die von der vorderen Sattelkante (Vorderzwiesel) bis zur Efter-Mitte messen. Das Resultat sind Abweichungen von bis zu zwei Zentimetern. Wer also perfekt in einen 16-Zoll-Sattel eines Herstellers paßt, kann in einem 16-Zoll-Sattel eines anderen Probleme bekommen.
Wieder andere Hersteller, etwa Kieffer, vermessen statt des kompletten Sattels den Sattelbaum. Mißt der Kieffer-Baum 36 Zentimeter (entspricht 16 bis 16 1/2 Zoll bei anderen Herstellern), wird er als Größe 0 bezeichnet. Größe 1 hat einen 39 Zentimeter langen Baum (entspricht 17 bis 17 1/2 Zoll), Größe 2 mißt 42 Zentimeter (entspricht 18 bis 18 1/2 Zoll).
Bei Westernsätteln sind die Sitzlängen generell etwas kleiner, weil sie von der Fork bis zum Ende des Cantle gemessen werden, also die reine Sitzfläche bezeichnen.
Noch verwirrender sind die Einteilungen bei der Kammerweite. Sie kennzeichnet den Freiraum zwischen den beiden Ortspitzen des Sattels und gibt damit auch Auskunft über die Winkelung des Sattels. Bei den meisten Herstellern reichen die Größen von 26 bis 36 Zentimeter.
Kieffer verzichtet ganz auf eine Angabe in Zentimetern und bietet lediglich drei Größen an: Small, Medium, Large. Auch die englische Firma Thorowgood beschränkt sich auf drei Größen: Small, Medium und Broad.
Sattel-Paßform für das Pferd erkennen

Doch viele Händler orientieren sich beim Probieren am Pferd nicht an den Maßangaben der Hersteller, sondern vertrauen auf ihre Erfahrung und ihr Auge.
Damit können sie zwar die Winkelung vorn und hinten sowie den Wirbelsäulenbereich einschätzen, jedoch nicht den Rücken- und Lendenbereich, den der Sattel verdeckt. "Die Fähigkeit, einen Sattel rein optisch anzupassen, spreche ich jedem ab", sagt Christoph Rieser, Sattler aus dem rheinland-pfälzischen Obersteinebach. "Mir selbst auch."
Außerdem stecken die Händler in der Klemme, weil sie unvereinbare Ansprüche erfüllen müssen. Sie sollen dem Kunden den ideal passenden Sattel möglichst billig und sofort verkaufen – selbst für ein Pferd mit schwieriger Sattellage. Wenn dieser Sattel anschließend drückt, landet der schwarze Peter sofort beim Händler.
"Wenn ich auf den Hof komme, um einen Sattel anzupassen, erwartet der Kunde, daß ich an diesem Tag auch einen passenden Sattel für sein Pferd dabei habe. Wenn nicht, muß ich trotzdem einen verkaufen", erzählt ein Händler aus Baden-Württemberg. "Wenn ich um ein paar Tage Aufschub bitte, sucht sich der Kunde lieber einen anderen Händler."
In Deutschland gibt es etwa 1500 bis 2000 Händler. "Etwa 1000 davon sind Fachgeschäfte, der Rest die sogenannten Kofferraumverkäufer", schätzt Sönke Lauterbach, Leiter der Abteilung Service der FN und zuständig für den Arbeitskreis Ausrüstung.
Der Arbeitskreis schult Händler regelmäßig zu Themen wie Paßform und Lederbearbeitung. Die Zahl der wirklich kompetenten Händler schätzt Lauterbach auf 200 bis 300.
"Von denen will jeder seine Kunden glücklich machen, weil er sie sonst verliert", sagt Lauterbach. Doch das ist nicht so einfach: "Manche Kunden wollen sich nicht beraten lassen. Sie wählen nur nach Farbe oder Marke. Die Händler kämpfen oft gegen die Eitelkeit der Kunden."
Manche Reiter sind beratungsresistent

Solche Sättel kommen fast immer nach zwei, drei Wochen als "Fehlkauf" zurück.
Grundsätzlich müssen nicht passende Sättel nach dem neuen Kaufrecht nachgebessert werden. Das gilt auch für den Kauf eines gebrauchten Sattels. Dabei kann der Käufer zwischen der Beseitigung des Mangels und einem Ersatz des Sattels wählen. Gelingt dem Verkäufer die Nachbesserung nicht, kann der Käufer sein Geld zurückverlangen.
In der Praxis kommt es darüber oft zum Streit. Denn wer letztlich entscheidet, ob ein Sattel paßt oder nicht, ist unklar. Stellt sich ein Händler stur, bleibt dem Käufer nur der Weg zum Gericht.
Andererseits klagen viele Händler über Kunden, die einen Sattel nach dem anderen ausprobieren und nach einigen Wochen als unpassend zurückgeben, obwohl sie selbst durch schlechtes Reiten oder falsche Sattelunterlagen für Scheuerstellen sorgen.
"Oft werden die Käufer auch von ihren Reitlehrern schlecht beraten", sagt Lauterbach. "In solchen Fällen ist der Händler hilflos."
Helfen kann in diesem Fall nur ein schriftlicher Kaufvertrag. In ihm steht, daß der Sattel dem Pferd zur Zeit der Anprobe paßte. Außerdem erklärt der Händler schriftlich, daß sich die Sattellage durch viele Faktoren (Futterzustand, Muskelaufbau, Haltung des Pferds) ändern kann.
Sinnvoll ist außerdem, die Maße des Pferds zum Zeitpunkt des Messens aufzuzeichnen und vom Käufer unterschreiben zu lassen. So spart sich der Händler Ärger, Zeit und Geld.
Für den Käufer ist ein solcher Vertrag nur sinnvoll, wenn er mit dem jeweiligen Händler bereits gute Erfahrungen gemacht hat und ihm vertraut. Verlassen kann er sich dabei nur auf den Ruf eines Händlers. Denn bislang gibt es für Händler keine Zertifikate, keine Ausbildung, keine Qualitätskontrollen und keine Pflicht zur Weiterbildung.
Wer darf mit Sätteln handeln?
Und die sind bei der Auswahl ihrer Händler nicht immer so wählerisch wie die Firma Passier, die vor allem jahrzehntelange Passier-Kunden zu Händlern macht. Kieffer wiederum setzt ausschließlich auf Händler, die ein Geschäft besitzen. So versucht sich die Firma vor inkompetenten Kofferraum- oder Internethändlern zu schützen.
"Es gibt aber Hersteller, die nur darauf achten, daß der Rubel rollt", sagt Lauterbach. Ihnen ist egal, ob der via Händler verkaufte Sattel dem Pferd tatsächlich paßt.
Viele Händler können Sättel nicht selbst verändern und aufpolstern, weil ihnen Wissen und eigene Werkstatt fehlen. Sie schicken den Sattel zum Ändern an den Hersteller zurück. Der verändert den Sattel, ohne das Pferd gesehen zu haben, was bei schwierigen Sattellagen nicht immer funktioniert.
Wer bei einem Händler kauft, sollte darauf achten, daß dieser selbst Sattler und Reiter ist und einen Sattel, wenn nötig, selbst ändern kann. So stellt die Sattlerei Hennig GmbH aus dem brandenburgischen Mühlenberge für ihren Außendienst-Service nur Sattler ein, die gute Reitkenntnisse haben. Vorbildlich sind auch Hersteller, die ihre Händler regelmäßig schulen.
So bietet zum Beispiel René Sommer für seine Händler im nächsten Jahr zwei Weiterbildungsseminare an. Außerdem können die Händler jederzeit in seine Firma kommen, um sich über aktuelle Sattelmodelle, Polsterung, Paßform und Lederqualität zu informieren.
Hat ein Kunde Probleme mit einem Sattel, sollte er beim Hersteller direkt anrufen können. Der schickt dann einen Fachhändler vorbei. Bekommt dieser das Problem auch nicht in den Griff, macht er Fotos und Videos vom Pferd und schickt diese an den Hersteller zur Analyse. Anhand der Fotos kann dieser den Sattel dann ändern.
Grundsätzlich lassen sich Sättel mit einem flexiblen, verstellbaren Baum leichter ändern. Doch das hat Tücken. So klingt es zum Beispiel gut, wenn damit geworben wird, daß der Kunde das Kopfeisen selbst verstellen kann.
Doch nicht immer ist der Kunde dafür kundig genug: Durch das Verstellen des Kopfeisens kommt der Sattel aus dem Gleichgewicht. Um das zu verhindern, muß das Kissen nach dem Verstellen des Kopfeisens nachgepolstert werden – und das wiederum kann nur der Sattler.
An Sätteln mit starrem, konventionellem Sattelbaum kann nur die Polsterung geändert werden. Eine Ausnahme sind Kunststoffbäume aus Thermoplast. Die Kammer eines solchen Sattels wird beim Fachhändler eine halbe Stunde lang mit einem Infrarot-Gerät erwärmt und anschließend in Form gebracht. Nach 24stündigem Auskühlen soll die Form der Sättel stabil bleiben und ideal auf den Rücken passen.
Ein guter Sattel sollte minimale Muskelveränderungen freilich tolerieren. Um diesen leichter zu finden, braucht es nicht nur einheitliche Maße, sondern auch kompetentere Händler und bessere Reiter, denen es beim Sattelkauf wirklich ums Pferd geht. Nicht um die eigene Eitelkeit.
Interview C. Rieser: Manche reiten grausam
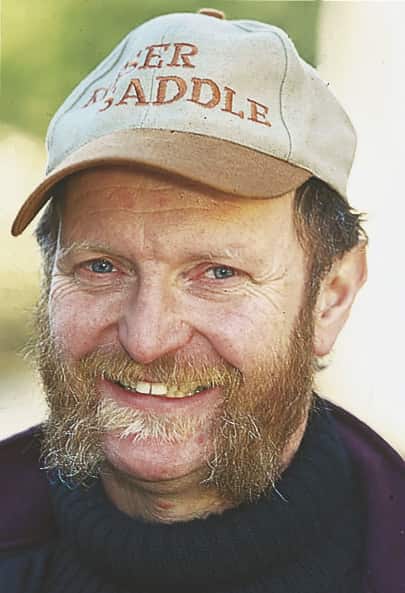
CAVALLO: Immer mehr Reiter sind bereit, viel Geld für passende Sättel zu zahlen. Warum klagen trotzdem so viele über unpassende Sättel?
Rieser: Das betrifft vor allem konventionell gefertigte Dressur-, Spring- und Vielseitigkeitssättel. Es liegt zum Teil daran, daß die Konstruktionen der meisten Sattelbaummodelle aus den 50er und 60er Jahren stammen oder noch älter sind. Bis dahin bekamen Reitpferde meist einen Sattel, wie wir ihn aus der Kavallerie kennen, mit einer breiten Auflagefläche und einem breiten Wirbelsäulenkanal und vor allen Dingen mit einem flächig tragfähigen Sattelbaum. Er verteilt das Gewicht des Reiters gut. Diese Sättel waren so gebaut, daß man auf ihnen stundenlang reiten konnte. Selbst wenn sie nicht optimal auf dem Pferd lagen, gab es beim Pferd nicht unbedingt ein Problem.
Warum wurden die Sättel verändert?
Mit dem Aufkommen ländlicher Turniere begann man, Sättel mit kleinerer Auflagefläche zu bauen. Sie wurden mehr tailliert, im Satz schmaler. Der Sattelbaum wurde seiner Tragfähigkeit beraubt. Sie boten aber dem Reiter mehr Komfort und wurden leichter. Ihre Maße gelten bis heute. Für den kurzfristigen, sportlichen Einsatz sind die Sättel in Ordnung. Heute sitzen viele Reiter jedoch fast täglich auf dem Pferd, reiten Dressur, gehen auf Distanz- und Wanderritte. Für Langzeitbelastungen waren diese Sättel aber nie gedacht.
Haben sich die Pferde nicht verändert?
Doch. Vor 30, 40 Jahren waren sie einheitlicher. Heute gibt es eine größere Rassenvielfalt. Auch innerhalb der Rassen nahmen die Typ-Unterschiede zu. Früher hatten die meisten Warmblüter eine ähnliche Figur. Heute gibt es viele Rassemixe, die ganz anders aussehen. Außerdem werden die meisten Pferde gut gehalten und gut gefüttert. Sie sind runder als früher – das ist nicht unbedingt ein Vorteil für die Sattellage.
Kann man die gute Sattellage nicht anzüchten?
Früher achtete man eher auf das Exterieur, zu dem auch eine gute Sattellage gehört. Heute züchtet man Spezialisten; Pferde mit raumgreifenden Gängen, Springkraft oder Töltveranlagung. Eine unkomplizierte Sattellage ist – obwohl fast immer Zuchtziel – in der Praxis nebensächlich. Das Ergebnis sind oft problematische Sattellagen, etwa ein hoher Widerrist, ein abgeflachter Rippenbereich oder ein Senkrücken. Solche Pferde bekommen mit einem konventionellen Sattel "von der Stange" besonders schnell Probleme.
Trotzdem haben manche auch mit Maßsätteln Probleme.
Häufig sind Handhabungsfehler die Ursache. Man kann Satteldruck zum Beispiel angurten, indem man zu lose oder zu stark gurtet. Zu dicke oder zu dünne Sattelunterlagen können zu Problemen führen. Außerdem kann der beste Sattel die fehlende Ausbildung von Pferd und Reiter nicht wettmachen. Die Leute reiten zum Teil grausam. Ich hatte eine Kundin, die sagte: "Ich habe den teuersten Sattel, das teuerste Pferd und trotzdem Probleme." Ich empfahl ihr, einmal über sich nachzudenken.
Weiterlesen:





