Pat Parellis "Natural Horsemanship"
Der US-Amerikaner Pat Parelli gründete 1981 ein Ausbildungskonzept mit dem Ziel, jedem Menschen und jedem Pferd einen Weg zu gelungener Kommunikation aufzuzeigen. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch, der lernen soll, sein Pferd besser zu verstehen. Das Training basiert auf vier Lernstufen, die aufeinander aufbauen: Partnerschaft, Harmonie, Verfeinerung, Vielseitigkeit. Begonnen wird mit den "Sieben Spielen", die an das Verhalten der Pferde untereinander angelehnt sind. Der Mensch kommuniziert mit dem Pferd, indem er stufenweise Druck aufbaut, der sofort nachlässt, wenn das Pferd wie gewünscht reagiert.
1. Friendly Game (Freundschaftsspiel): Das Pferd lernt, sich am ganzen Körper berühren zu lassen.
2. Porcupine Game (Stachelschwein-Spiel): Das Pferd lernt, kontinuierlich gesteigertem Druck zu weichen.
3. Driving Game (Fahrspiel): Das Pferd lernt, rhythmischem Druck zu weichen.
4. Yo-Yo-Game: Das Pferd wird rückwärtsgeschickt und wird wieder eingeladen, herbeizukommen.
5. Circling Game: Das Pferd lernt, die vom Menschen gewünschte Gangart, Geschwindigkeit und Richtung selbstständig beizubehalten.
6. Sideways-Game: Das Pferd lernt, seitwärts zu weichen.
7. Squeese-Game: Das Pferd lernt, einen engen Raum zu akzeptieren.
Das Join-up von Monty Roberts
Der amerikanische Pferdetrainer Monty Roberts machte seine Trainingsmethode "Join-Up" 2002 bekannt, als er sein Buch "Die Sprache der Pferde" veröffentlichte: In einem Roundpen wird das Pferd getrieben, bis es zu verstehen gibt, dass es dem Menschen zuhört. Indem der Mensch sich abwendet und den Druck auflöst, erlaubt er dem Tier, sich ihm anzuschließen und zu folgen.
Welche Rolle spielen Respekt und Dominanz im Training?
"Ich möchte nicht dominieren" Das Thema Dominanz im Pferdetraining sollte sich doch mittlerweile erledigt haben. Zum Glück hat sich im Natural Horsemanship viel getan. Basierend auf dem Urgedanken wird statt Dominanz mehr mit Respekt sowie positiver Verstärkung gearbeitet. Ich möchte das Pferd nicht dominieren, aber es soll mir gegenüber immer aufmerksam sein. (Michael Geitner)

"Respekt entsteht nur durch gute Führung"
Ich möchte, dass die Pferde uns respektieren. Genauso sollen die Pferde auch wissen, dass wir sie respektieren. Das ist etwas, was man sich nicht durch Leckerli erschleichen kann. Aus Respekt wächst Vertrauen in die Führungsqualitäten des Menschen. Und daraus entsteht, wenn alles gut läuft, eine Freundschaft zwischen Mensch und Pferd. Dominanz spielt eine untergeordnete Rolle, da sich Pferde einer Herde nicht anschließen, um dominiert zu werden, sondern aus dem einfachen Grund der Obhut. Sie möchten jemanden, der gut auf sie aufpasst. (Bernd Hackl)
"Dominanz wurde häufig falsch verstanden"
"Dominanz" stammt ab von dem lateinischen Wort "dominus" ("Hausherr"). Also jemand, der aufpasst, die Verantwortung hat, auf den man sich verlassen kann. Dominanz steht also nicht für Unterdrücken, Herrschen, Zwingen, Befehlen, wie es in der Vergangenheit gerne interpretiert und angewendet wurde.
"Respekt" heißt übersetzt "Wahrnehmung", also den anderen zu sehen und seine Bedürfnisse als wahr anzunehmen. Respekt dem Pferd gegenüber zu haben, bedeutet für uns, ihm zu glauben, wenn es etwa Angst hat und ihm zu helfen, anstatt es zu reglementieren. Ein Pferd, das wiederum den Menschen respektiert, wird diesem zuhören und gerne mit ihm kommunizieren. (Jenny Wild und Peer Claßen)
Hat das Pferd ein Mitspracherecht, und wann darf es Nein sagen?
"Meine Pferde dürfen fragen"
Ich stehe mit meinen Pferden im Dialog. Wenn die Beziehung gut ist, gibt es keine festen Regeln. Wenn sie fragen, versuche ich ihnen das, was sie möchten, so oft wie möglich zu erlauben. Wer das anders sieht, hat keine natürliche Beziehung zum Pferd.
Grenzen muss ich setzen bei Pferden, die keine gute Kommunikation gewohnt sind. Dann geht es etwa darum, meinen persönlichen Raum abzugrenzen. Ich glaube: Je kompetenter der Pferdemensch ist, desto weniger Regeln muss er aufstellen. (Ralf Heil)
"Ich habe gelernt, auch mal nachzugeben"

Heute beiße ich mich nicht mehr durch, damit ich jedes Training mit einem Erfolg abschließen kann. Wenn mal gar nichts geht, dann beende ich das Training und mache am nächsten Tag weiter. (Michael Geitner)
"Innerhalb ihrer Grenzen haben meine Pferde alle Freiheiten"
Natürlich gibt es Situationen, in denen ich als Reiter abwägen sollte, ob es mir wichtig ist, die gelöste Stimmung mit meinem Pferd zu stören. Zum Beispiel, weil es partout nicht in die obere Hälfte der Halle will, ohne dabei angespannt und schreckhaft zu werden. Je nach Pferd arbeite ich dann vorwiegend in der unteren Hälfte, bis meine Hilfen vom Pferd gut angenommen werden und ich mir verschiedene Punkte erarbeitet habe.
Ich persönlich würde jedoch nicht über Tage hinweg mein Pferd darin bestärken, ein Problem zu umgehen. Früher oder später, in meinem Fall in spätestens drei Tagen, konfrontiere ich mein Pferd mit dem Problem, um eine Lösung zu finden. Mag sein, dass ich es dann mit einem zweiten Pferd als Unterstützung angehe oder vielleicht auf Bodenarbeit oder Doppellonge zurückgreife. Fakt ist: Ich werde auf jeden Fall versuchen, an bestehenden Problemen zu arbeiten.
Wo ich definitiv ein Veto zulassen muss, ist etwa bei der Arbeit mit dem Ponyhorse, also einem Handpferd, das mich als Reiter unterstützt. Mein Ponyhorse Fips erkennt Situationen schneller als ich und reagiert instinktiv zuverlässig auf Mimik und Drohgebärden von teilweise gefährlichen Pferden, mit denen wir arbeiten. So kann es sein, dass er bei der Arbeit hier und da eine eigene Entscheidung trifft. Ich sehe das als Empfehlung seinerseits. Dennoch müsste ich nicht mit Gewalt einwirken, wenn ich anderer Meinung wäre.
Bei der Arbeit mit schwierigen Pferden passieren die Dinge manchmal sehr schnell, und unserer beider Gesundheit hängt in erster Linie von der Leichtigkeit und Zuverlässigkeit unserer Kommunikation ab. Deshalb sind lange Diskussionen weder hilfreich noch möglich, weil sich innerhalb eines Bruchteils von Sekunden die Voraussetzungen ändern können.
Generell gilt: Wie bei Kindern gehört zu unserer Aufsichtspflicht für die Pferde auch das Durchsetzen von Grenzen. Innerhalb ihrer Grenzen haben meine Pferde alle Freiheiten. Gerade bei der Arbeit, zum Beispiel an Rindern, darf ein Pferd die Entscheidung des Reiters nicht in Frage stellen. Und dennoch sollte es nicht so sein, dass unser Pferd sich als Sklave fühlt, sondern eine freundschaftliche Beziehung unser Zusammenleben prägt. (Bernd Hackl)
"In manchen Situationen kann ich meinem Pferd Freiheiten gewähren"
Natürlich muss ich in der Lage sein, meinem Pferd zuzuhören. Dazu gehört, dass ich viele Pausen beim Training mache, die Trainingseinheit sinnvoll aufbaue, es lobe und vor allem, eine gute Zeit mit ihm verbringe und nicht immer eine Aufgabe habe, wenn ich bei ihm bin. Wenn es Zeichen von Müdigkeit zeigt, sollte ich das Training früher beenden.
Trotzdem muss es Konsequenz im Training geben. Erst wenn die Übung gut geklappt hat, hören wir auf. Sicherheit ist das oberste Prinzip und da gibt es keine Entscheidungsfreiheit! Wenn ich vor der Schnellstraße abbiegen möchte, darf mein Pferd nicht von selbst geradeaus weiterlaufen. An anderer Stelle kann ich Freiheiten gewähren. Meine Stute Phoenix möchte zum Beispiel beim Ausritt nicht gerne an erster Stelle laufen. Manchmal muss das sein, wenn ich eine Reitgruppe führe. Aber wenn ich mit Freunden reite, kann ich sie auch an ihrer Lieblingsposition laufen lassen. (Constanze Weinzierl)
"Regeln müssen keine pauschalen Verbote sein"
Regeln sind in erster Linie dazu da, uns und unsere Pferde zu schützen. Ein Pferd weiß zum Beispiel nicht, dass es gefährlich ist, über die Straße zu laufen. Wir nutzen also unsere Kompetenz, um es durch die Welt zu führen.
Entscheidungsfreiheit kann und sollte das Pferd aber immer wieder haben, damit es sich wahrgenommen fühlt und motiviert bleibt. Ich muss aber immer in der Lage sein, einzuschreiten und Grenzen zu setzen. Wie ich das handhabe, hängt von der Situation ab und setzt eine gute Beziehung zwischen mir und dem Pferd voraus. Konkret: Ich sage nicht pauschal, dass mein Pferd mich nicht beschnüffeln darf. Es darf das tun, soll aber aufhören, wenn ich das nicht mehr möchte. Es darf auch mal seine Nase ins Gras stecken, aber wenn ich weitergehen möchte, sollte es mir auch folgen. Wer für sein Pferd ein vertrauenswürdiger Leader ist und mit ihm gut kommunizieren kann, ist also durchaus in der Lage zu differenzieren. Dann sind keine Pauschal-Verbote nötig.
Wenn ich aber einem Pferd immer etwas erlaube und plötzlich nicht mehr, können Probleme entstehen. Das Pferd muss lernen, dass es auch mal seine eigenen Entscheidungen zurückzunehmen muss. Kann es das (noch) nicht, ist es sinnvoller, eine klare Linie zu fahren.
Dass die Entscheidungsfreiheit des Pferds so weit geht, dass sein Reiter es fragt, ob es geritten werden möchte oder nicht, ist in meinen Augen eine Grundsatzfrage. Denn wer sich ein Pferd anschafft, hat doch immer eine Erwartung an das Tier. Wenn es nicht das Reiten ist, dann ist es etwas anderes, was der Besitzer mit dem Tier unternehmen möchte.
Eine konfliktfreie Beziehung ist Wunschdenken, denn die gibt es nicht. Wer Konflikte scheut, müsste sein Pferd streng genommen auf der Weide lassen. Aber ganz ehrlich: Auch ich muss mal etwas machen, wozu ich keine Lust habe. Das schafft auch das Pferd – wenn es ihm ansonsten gut geht. Denn zum Horsemanship gehört selbstverständlich auch eine artgerechte Haltung. (Dr. Vivian Gabor)
"Wir müssen dem Pferd das Gefühl geben, dass es mitsprechen darf"
Für mich ist es tatsächlich wichtig, dass ein Pferd ein gewisses Mitspracherecht hat. Damit meine ich, dass es zumindest denkt und fühlt, dass es ein Mitspracherecht hat.
Letzten Endes bestimmen wir Menschen, in welche Richtung, in welchem Tempo und wie lange das Pferd sich bewegt. Denn wir müssen ein so starkes Tier nun mal händeln, bändigen und lenken können. (Katja Schnabel)
Sind Monty Roberts’ Join-Up oder Pat Parellis Natural Horsemanship überholt?
"Es gibt nicht den einzig richtigen Weg"
Viele verstehen das Horsemanship falsch. Es wird oft vermittelt, dass Horsemanship eine Aneinanderreihung von zum Teil zirzensischen Lektionen wäre. So bekomme ich manchmal Anfragen von Menschen, die ihre Pferde in "Horsemanship" ausbilden lassen wollen. Sie erwarten dann, dass die Pferde ihnen nach der Ausbildung nachlaufen wie ein Hund, rückwärts um Tonnen rangieren, sich hinlegen und auf Kommando steigen. Darum geht es aber nicht.
Durch meine Arbeit in den USA, bei der ich viel mit Cowboys zu tun hatte, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein starres Denken, auf welche Art auch immer, einschränkt. Und dennoch ist es wichtig, dass Einsteiger einen Leitfaden haben, an dem sie sich orientieren können.
Aus meiner Sicht wird dabei leider zu wenig vermittelt, wie wichtig es ist, offen für Neues zu bleiben. Ich mag dieses oft zu beobachtende Jüngertum nicht, bei dem eine einzige Methode als die Offenbarung gefeiert wird. Ich glaube, es schränkt die Pferdewelt sehr ein, hirnlos einem aktuellen Hype nachzulaufen. Das Phänomen ist vor allem bei Einsteigern und Hobbytrainern zu beobachten. Profis untereinander kennen Diskussionen über "den einzig richtigen Weg" nicht. Meiner Meinung nach ist die wichtigste Aufgabe eines Pferdemenschen, sich in Situationen hineindenken zu können und sich an die Stelle ihres Pferdes zu versetzen. Bei uns auf der 7P-Ranch gibt es durch die verschiedenen Pferderassen und den doch oft unterschiedlichen Ausbildungsstand zwar eine ungefähre Richtung in der Ausbildung der Pferde, aber keinen starren Plan. (Bernd Hackl)

"Ich spiele nicht Parelli, bis das Pferd abschaltet"
Hier muss man sich zunächst fragen, welchen Zweck die Trainingskonzepte haben. Beim Join-Up geht es meiner Meinung darum, Techniken und Strategien zu erlernen, um das Pferd zu beeindrucken.
Parellis Natural Horsemanship ist ein Programm für Menschen, die lernen, Pferde auszubilden. Das benötigt am Anfang professionelle Unterstützung. Der Mensch muss dahin kommen, dass er nicht mehr darüber nachdenkt, was er tut. Denn wer beginnt zu denken, ist für das Pferd schon zu spät. Dann sind Pferde unterfordert und merken: Der Mensch hat mich nicht verstanden. Am Anfang finden Pferde die Parelli-Spiele noch spannend: Wow, der Mensch kommuniziert in Phasen! Werden Dinge ein paar Mal wiederholt, fragen sie sich: Was kommt jetzt? Hierin liegt die Herausforderung für den Menschen: Ich spiele nicht Parelli, bis das Pferd genervt ist und abschaltet, sondern um etwas über mich und mein Pferd zu erfahren. (Ralf Heil)
"Das Join-Up haben wir modifiziert"
Nein, die Trainingsmethoden sind nicht überholt. Denn am Anfang der Beziehungsarbeit bei Mensch und Pferd steht, eine solide Bindung zu erarbeiten und die Führung zu klären. Der Mensch muss das Leittier sein. Nur dann fühlt sich ein Pferd sicher, kann entspannen und sich auf den Menschen einlassen. Deswegen ist Natural Horsemanship auch für jeden Menschen und jedes Pferd, egal welche Rasse oder welche Reitweise, geeignet.
Das Join-Up haben wir jedoch in unserem Freiarbeitstraining modifiziert: Wir schicken das Pferd nicht gleich weg, sondern versuchen es erst mit freundlicher Annäherung. Schließt sich das Pferd an, ist das super. Wenn nicht, können wir es immer noch bewegen. (Constanze Weinzierl)
"Wir ersetzen Technik durch Gefühl"
Wir haben viel von dem, was wir beim konventionellen Horsemanship gelernt haben, inzwischen ad acta gelegt. Das bedeutet jedoch nicht, dass es kein guter Einstieg für uns war. Besonders das Parelli-System ist sehr gut strukturiert und bietet durch seinen Aufbau und durch seinen Umfang unserer Ansicht nach eine tolle Möglichkeit, im Horsemanship wirklich gut zu werden. Tatsächlich haben wir uns irgendwann aber von diesem Weg gelöst und uns für andere Richtungen und Ansichten geöffnet. Wir haben es geschafft, diese miteinander zu verknüpfen.
Was uns persönlich nicht mehr so gut gefällt, ist das Erarbeiten vom Groben zum Feinen. Wir versuchen, soweit dies möglich ist, unseren Schülern direkt die Feinheit und Sensibilität zu vermitteln, die Pferde sich von ihren Menschen wünschen. Wir möchten jedem ans Herz legen, immer in sich selbst und das Pferd hineinzuhorchen: Fühlt sich alles gut und richtig an? Oder war zu viel Druck im Spiel? Im letzteren Fall würden wir heute auch selbst eher intervenieren, als wir das früher gemacht haben, wenn wir woanders auf einem Kurs waren. (Jenny Wild und Peer Claßen)
"Gefühl und Körpersprache werden oft vergessen"
Überholt nicht, aber wichtige Zutaten wurden oft vernachlässigt. Vielleicht könnte man Trainingskonzepte mit dem Kochen vergleichen. Für Anfänger ist ein Rezept hilfreich, damit sie ein Gericht kochen können. Ein guter Koch wird aber nur der, der ein Gefühl entwickelt, welche Zutaten in welcher Menge zueinanderpassen und ob das Ergebnis stimmig ist. Wer beim Pferdetraining, genau wie übrigens auch beim Reiten, nur mit Technik arbeitet, dem fehlen wichtige Zutaten.
Ohne Gefühl und Körpersprache agiert der Mensch wie ein Roboter. Das Ergebnis ist ein Pferd, das konditioniert auf Signale reagiert, aber den Menschen an sich gar nicht wahrnimmt. Zwei Beispiele: Wer sein Pferd etwa nur über die Stimme arbeitet, hat möglicherweise ein Problem, wenn es anhalten soll, weil ein Traktor vorbeiknattert. Und wer sein Tier nur auf Fingerzeig dirigiert, muss damit rechnen, dass es ihn übersieht, wenn er es in einer Gefahrensituation anhalten möchte.
Ich bin der Meinung, dass wir aufhören müssen, eine Trainingsmethode dogmatisch zu sehen. Ich möchte meinen Schülern viele Wege aufzeigen, unter denen sie dann, dem Pferd und der jeweiligen Situation entsprechend, wählen können. Ich denke, so haben auch Monty Roberts und Pat Parelli ihre Trainingsmethoden verstanden. Deshalb finde ich es schade, dass das Horsemanship von manchen so negativ gesehen wird. Es hängt eben immer davon ab, wer es macht und wie es gemacht wird. So wie beim Reiten auch: Wer die FN-Reiterei ablehnt, lehnt eigentlich nur das ab, was manche Reiter daraus machen. Denn die Richtlinien selbst sind eine gute Grundlage. (Dr. Vivian Gabor)
"Lieber klassisch europäisch als schnell amerikanisch"
Parelli funktioniert und gibt dem Menschen ein gutes Gefühl. Es ist doch immer toll, wenn wir jemanden schicken können. Join-Up wird heute aus wissenschaftlicher Sicht mit erlernter Hilflosigkeit in Verbindung gebracht (Anm. d. Red.: 2012 zeigte eine Studie der Veterinärmedizinischen Universität von Sydney auf, dass Monty Roberts’ Join-Up-Methode auf psychischem Druck basiert). Mit beiden Methoden habe ich ein Problem, wenn sie nur dazu dienen, das Pferd damit zu konfrontieren, bestimmte Dinge machen zu müssen. Wer mal in den USA im tiefsten Hinterland war, weiß, dass es dort endlos viele Pferde gibt. Dort braucht man ein System, um diese Masse an Tieren zu managen. Es ist keine Seltenheit, dass zwei Trainer in einer Woche 50 Jungpferde einreiten.
Als sich in Europa die Freizeitreiterszene entwickelte, fehlten entsprechende Ausbilder. Es gab kaum Reitlehrer, die alternativen "Normaloreitern mit Zottelpferden" helfen wollten. Deshalb wurden die amerikanischen Methoden von Pat Parelli oder Monty Roberts so populär. Sie wirken herrlich einfach und führen schnell ans Ziel. Der klassische Weg auf Grundlage beispielsweise der deutschen Reitlehre ist dagegen sehr aufwändig, langwierig und erfordert viel Disziplin. Ich mag den Trend zurück zur Klassik, mit einer guten Grundausbildung, die mindestens drei Jahre dauert. Das Ziel einer guten Ausbildung ist für mich, das Pferd in die Lage zu versetzen, sich in seinem Körper wohlzufühlen – auch unter dem Sattel. (Michael Geitner)
Trainings-Tipps für mehr Achtsamkeit
"Wenn du deinem Pferd etwas beibringen willst und nur 15 Minuten Zeit hast, brauchst du 2 Tage. Wenn du aber so tust, als hättest du 2 Wochen Zeit, dauert es nur 15 Minuten." (Monty Roberts)
Zeit bringt mehr Erfolg als Regeln. Michael Geitner arbeitet nicht nur mit problematischen Pferden, sondern auch mit straffällig gewordenen Jugendlichen. Er sagt: "Die, die sich am schlechtesten benehmen, haben meistens das geringste Körperbewusstsein." Beim Pferd sei das auch so: Je weniger es sich in seinem Körper wohlfühlt, desto widersetzlicher verhält es sich. "Früher war ich immer beeindruckt, wie brav sich die Jungpferde mancher klassischer Ausbilder auf großen Veranstaltungen präsentieren.
Heute weiß ich, warum: Die Trainer hatten diese Pferde durch eine gute Grundausbildung von mehreren Jahren für solche Herausforderungen vorbereitet", betont der Trainer. So hatten die Tiere genug Zeit, Koordination, Körperbewusstsein und Balance zu entwickeln. Denn für das Fluchttier Pferd ist es essenziell, das Gefühl zu haben, seinen Körper kontrollieren zu können. Das macht es souverän und selbstbewusst – nicht nur in fremder Umgebung, sondern auch zu Hause in der eigenen Herde.

"Pferde lehren Menschen und Menschen lehren Pferde." (Pat Parelli)
Die Sieben Spiele als Werkzeugkasten nutzen: Das Parelli-Konzept versteht Ralf Heil nicht als starres System, um dem Pferd nacheinander verschiedene Dinge beizubringen. Die Sieben Spiele etwa sollten nicht dazu genutzt werden, um so lange zu üben, bis das Pferd endlich das ausführt, was der Mensch von ihm erwartet. Dann befindet sich das Pferd so lange in einer unkomfortablen Situation, bis es nachgibt. Echtes Verständnis und Kommunikation bleiben dabei auf der Strecke. "Ich sehe die Parelli-Spiele als Werkzeugkasten", betont der Trainer. Die Spiele dienen dazu, sich selbst und das Pferd besser kennenzulernen und Probleme besser lösen zu können. Im Frage-Antwort-Spiel klärt er zum Beispiel, ob das Pferd extrovertiert oder introvertiert ist, ob es Aufgaben eher mit dem Kopf oder in der Bewegung löst und ob es unsicher oder selbstbewusst ist.
Wenn Sie in einen Dialog mit Ihrem Pferd gehen wollen, suchen Sie das passende Spiel dafür aus. Beispiel Yo-Yo-Spiel: Sie schicken Ihr Pferd weg und laden es dann wieder zu sich ein. Für Ralf Heil steckt in dem Spiel eine wichtige Information: Kommt das Pferd auf Ihre Einladung nicht zu Ihnen, haben Sie herausgefunden, dass Sie gerade keine gute Verbindung zu Ihrem Pferd haben. Das Vertrauen fehlt. Wenn das Pferd andererseits nicht weichen und rückwärts gehen möchte, fehlt der Respekt. Mit dem Yo-Yo-Spiel können Sie also Ihre Beziehung zum Pferd überprüfen, die auf zwei Säulen beruht: Vertrauen und Respekt.
"Wenn dein Pferd Nein sagt, hast du entweder die falsche Frage gestellt oder falsch gefragt." (Pat Parelli)
Hinterfragen statt durchsetzen. Wer mit Pferden arbeitet, muss flexibel sein. Und dazu gehört, dem Pferd gegenüber nicht nur als "Sender" aufzutreten, der Aufgaben erklärt, sondern auch die Botschaften seines Gegenübers zu empfangen und darauf zu reagieren. Wenn das Pferd "Nein" sagt, hat es einen Grund. Viele Reiter denken, Sie müssten bestimmte Dinge durchsetzen, weil es heißt: "Da muss der Gaul halt durch." Michael Geitner rät: Hören Sie mehr aufs Bauchgefühl und nicht auf das, was andere im Stall sagen. Denn das Bauchgefühl ist oft richtig. Die Einstellung, man müsse das Pferd durch etwas hindurchzwingen, hält er für überholt.
Ein Beispiel, über das manche Reiter belustigt den Kopf schütteln: Der Reiter trägt den Sattel zum Pferd, entscheidet dann aber aus einem Gefühl heraus, doch nicht zu reiten. Das muss nichts mit übertriebener Fürsorge zu tun haben. Im Gegenteil: Vielleicht geht es dem Tier an dem Tag nicht so gut oder es ist in einer angespannten Stimmung. Die situative Entscheidung gegen das Reiten kann also das Pferd und den Reiter schützen.
Trainerin Katja Schnabel unterscheidet, warum das Pferd "Nein" sagt. Fragen Sie sich deshalb immer: Widerspricht es, weil es Schmerzen hat oder weil es etwas nicht verstanden hat? Oder möchte es einfach nicht das tun, um was wir es gerade bitten? In letzterem Fall sollten Sie einen Weg finden, um das Pferd zu motivieren und es auf Ihre Seite zu ziehen. Es hilft ungemein, die Bitte eher als Einladung zu formulieren statt als Befehl. "Wenn Sie eine Einladung aussprechen, bringen Sie ganz automatisch positive Gefühle mit und nehmen eine weichere Körpersprache ein", erklärt sie. Diese innere Einstellung sei ein wichtiger Schlüssel zu einer noch besseren Verbindung und Beziehung zum Pferd.
Katja Schnabels Tipp: Leisten Sie liebevolle Überzeugungsarbeit und ärgern Sie sich nie, wenn Ihr Pferd nicht sofort das tut, was Sie möchten.

"Mein Ziel ist es, dem Pferd Equipment anzubieten, das Sinn macht, das bequem ist und das meine Botschaften klar übermittelt... und vor allem etwas, das meine Kommunikation und mein Gefühl verbessert." (Pat Parelli)
Mehr Gefühl, weniger Technik. "Aus unserer Sicht macht einen guten Horseman aus, dass er in erster Linie an sich selbst arbeitet und erst in zweiter Linie am Pferd", sagen Jenny Wild und Peer Claßen. Das Parelli-Horsemanship sei, neben einigen anderen Trainingskonzepten, eine gute Schule für Menschen, die lernen möchten, ihr Verhalten gegenüber dem Pferd zu reflektieren, indem sie lernen, seine Reaktionen wahrzunehmen und zu verstehen. Das gelingt in erster Linie mit Erfahrung und Bewusstsein für die eigene Körpersprache.
"Es darf nicht dazu führen, dass man ohne den Stick als Hilfsmittel beim Pferd keine Chance mehr hat", meint Dr. Vivian Gabor. Konditionierung sei an sich nichts Schlechtes. Aber wer sein Pferd nur auf einzelne Signale konditioniert, etwa einen Fingerzeig oder ein Kommando, macht nicht nur das Tier zum Roboter, sondern verhält sich selbst wie einer. "Wir können Pferden nur Schutz bieten und als Leader agieren, wenn sie uns als Menschen wahrnehmen", betont die Verhaltensforscherin. Dann funktioniert die Kommunikation zum Beispiel so: Das Pferd läuft los, wenn der Mensch losläuft und es hält an, weil der Mensch stehenbleibt.
Konditionierte Pferde können weder im Notfall sicher kontrolliert werden noch von anderen Personen. Wird ein Signal nicht wahrgenommen, fehlt es oder wird es nicht so eingesetzt, wie das Pferd es kennt, trifft das Tier im Zweifelsfall seine eigene Entscheidung.
Kommentar
In Reitställen wurde es vor vielen Jahren modern, nach Parelli zu trainieren. Ich habe die "Seilchenschwinger" immer skeptisch betrachtet. Trotzdem probierte ich die Parelli-Spiele vor nicht allzu langer Zeit aus – und gab schnell auf. Eine Aufgabe nach der anderen abzuspulen, ergab für mich keinen Sinn. Und mein Pferd sah das wohl auch so.
Nach "Schema F" funktioniert Horsemanship für mich nicht. Das ist mir zu einseitig. Kommunikation mit dem Pferd heißt: Nicht nur "Sender" sein, sondern auch auf Empfang schalten. Gut, dass die meisten Horsemanship-Trainer das heute auch so sehen.

Nadine Szymanski, CAVALLO-Redakteurin
Die Experten

Dr. Vivian Gabor ist Trainerin und Pferdeverhaltensforscherin. Sie bildet an ihrem Institut für Verhalten und Kommunikation bei Göttingen Verhaltenstrainer aus. www.vivian-gabor.de

Michael Geitner wurde bekannt mit seinem Trainingskonzept "Be strict". Er hat die Dualaktivierung mit den blau-gelben Gassen und die Equikinetic erfunden. www.pferde-ausbildung.de

Ralf Heil ist 3-Sterne-Parelli-Instruktor. Auf seinem Birkenhof im Rheingau bildet er Reiter und Pferde nach den Prinzipien des Natural Horsemanship aus. www.birkenhof-heil.de
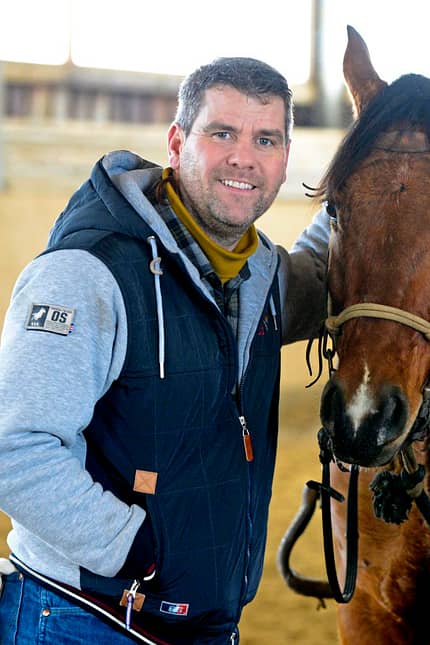
Bernd Hackl ist bekannt durch die VOX-Sendung "Die Pferdeprofis". Der Horseman hat sich der Ausbildung von Freizeit- und Problempferden verschrieben. www.berndhackl.de

Jenny Wild und Peer Claßen sind Horsemanship-Trainer, schreiben Fachbücher und geben Kurse. Im Fokus ihrer Ausbildung: der Mensch. www.peerundjenny.de

Katja Schnabel ist Pferdetrainerin bei der VOX-Sendung "Die Pferdeprofis". Ihr Steckenpferd: die Bodenarbeit auf Grundlage des Horsemanship. www.katja-schnabel.de

Constanze Weinzierl führt mit ihrem Mann Uwe Weinzierl ein Horsemanship-Zentrum in Mecklenburg-Vorpommern. www.uweweinzierl.de





