Wann darf man die Hilfen, wie in den Richtlinien beschrieben, abwandeln?
"Die Hilfen sind ein für das Pferd unmissverständliches System von Anweisungen. Damit ist der Reiter in der Lage, seinem Pferd in allen Bereichen schnell und konsequent zu vermitteln, was er von ihm erwartet. Die Hilfengebung kann abgewandelt werden. Das sollte aber nur sehr erfahrenen Ausbildern und Reitern vorbehalten bleiben, die diese dann auch an Schüler weitergeben können. Man kann dies mit Handwerksberufen vergleichen, bei denen die Gesellen früher auf die Walz gegangen sind, um von anderen Meistern neue Arbeitsverfahren zu lernen."

"Die Richtlinien können für die Hilfengebung nur einen Rahmen bilden, denjede(r) Ausbilder(in) mit eigenen authentischen Erklärungen füllen muss. Aber es gibt schon ein paar Punkte, bei denen ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Formulierungen in den Richtlinien zu typischen Missverständnissen führen können. Ich will mich bewusst nicht in einen Gegensatz zu den Richtlinien stellen, aber ich erkläre – speziell mit dem Hintergrundwissen über funktionelle Anatomie des Menschen – manche Themen anders. Bei der Beurteilung der korrekten Ausführung wäre ich vermutlich mit den Vertretern der Abteilung Ausbildung der FN am Ende allerdings wieder völlig einig."

"Ich bin total für die Richtlinien, da sind im Laufe der Jahre viele gute Leute dran gewesen. Manchmal stelle ich aber fest, dass Trainer zu wenige Ideen haben, wenn Hilfen oder Übungen wie in den Richtlinien beschrieben nicht funktionieren. Es erfordert viel Erfahrung, dem Reiter die Hilfengebung so zu erklären, dass das Pferd sie versteht. Dabei darf man meiner Meinung nach nicht nach Schema F vorgehen. Die Einwirkung muss zur Situation und zum Pferd passen. Am Ende kommt es auf die harmonische Verständigung von Reiter und Pferd an. Wenn dafür Varianten zu den Richtlinien zielführend sind, ist es absolut in Ordnung, diese auch anzuwenden."

Anreiten im Schritt
Richtlinien*: "Zum Anreiten im Schritt aus dem Halten schließt der Reiter sein Pferd für einen kurzen Augenblick in seine Hilfen ein. Besonders die vorwärtstreibenden Schenkel des Reiters animieren das Pferd dazu anzutreten. Sobald das Pferd auf die Hilfen reagiert und ansetzt, Schritt gehen zu wollen, lässt er unmittelbar die Vorwärtsbewegung mit der nachgebenden Zügelhilfe heraus, ohne die Verbindung zum Pferdemaul aufzugeben. Der Reiter geht dann in die Bewegung des Pferdes ein, indem er seinen Körper der Vorwärtsbewegung des Pferdes geschmeidig anpasst.
Der Reiter soll beim Anreiten das Pferd mit seinen tief und nah am Gurt liegenden Unterschenkeln umschließen. Er spürt es am besten, wenn er mit den Absätzen aus lockeren Fußgelenken heraus nach unten in die Steigbügel federt. [...]."
* Alle Richtlinien-Beschreibungen zitiert aus: Grundausbildung für Reiter und Pferd – Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 1, Copyright 2012 FN-Verlag. Die Richtlinien enthalten auch Hinweise zu häufigen Fehlern und Tipps zur Ausführung, erhältlich unter www.fnverlag.de

Friedhelm Petry: Leider beobachte ich beim Anreiten oft ein "tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert". Bei zu wenig sensiblen Pferden empfehle ich darum, nicht drei bis fünfmal zu knuffen, sondern den ersten Impuls direkt energischer zu geben. Als Variante kann man dann auch mal direkt zeitgleich mit einem Impuls von Schenkel und Gerte arbeiten. Reagiert das Pferd, muss ich dann sofort aufhören zu treiben und loben. Außerdem empfehle ich, zusammen mit dem Vorbereiten aus dem Sitz die Zügel nachzufassen. Da sich das Pferd beim Anreiten von hinten nach vorne zusammenschiebt, muss ich das Zügelmaß anpassen. Tue ich das erst nach dem Losreiten, spürt das Pferd einen Impuls am Maul und wird direkt wieder ausgebremst. Das ist falsch, im Gegenteil: Ich muss nachgeben und trotzdem in Kontakt bleiben können.
Knut Krüger: Ich lege Wert darauf, die treibenden Schenkelhilfen abzustufen. Die Beine geben einen sehr leichten kurzen Impuls vom Halten zum Schritt, einen deutlicheren, eventuell auch längeren Impuls vom Halten zum Antraben. Die Hand geht beim Beginn der Bewegung vor.
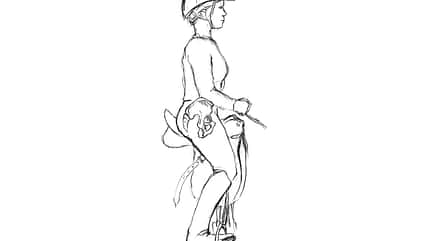
Isabelle von Neumann-Cosel: Gegenüber den Richtlinien lege ich beim Anreiten viel mehr Augenmerk auf die Gewichtshilfe. Die Richtlinien-Beschreibung betont die Schenkelhilfen, dabei lässt sich hier noch feiner kommunizieren. Zunächst muss der Reiter seine Körperspannung erhöhen und seine Gesäßknochen in Richtung vorderer Sattelschräge drehen (halbe Parade). Dabei darf er sich aber nicht nach hinten lehnen, sondern muss seinen Brustkorb trotzdem nach vorne und damit in die gewünschte Bewegungsrichtung des Pferds bringen. Das Pferd wird immer aus Reflex unter unseren Körperschwerpunkt treten und sich also ebenfalls nach vorne bewegen.
Angaloppieren aus dem Trab
Richtlinien: "Das Pferd wird durch vorbereitendes Einschließen in die Reiterhilfen vermehrt ,geschlossen' […]. Die innere Hüfte wird etwas nach vorne geschoben und dabei der innere Gesäßknochen vermehrt belastet [...,] das Becken [dazu] nach vorne-innen bewegt bzw. gerollt. Der rechte Schenkel liegt vorwärtstreibend unmittelbar am Sattelgurt.
Der rechte Zügel sorgt bereits in der Vorbereitung des Angaloppierens bei dem Pferd für die gewünschte Stellung in Genick und Hals nach rechts. Der äußere verwahrende Zügel lässt die Stellung zu, begrenzt sie […].
Der äußere Schenkel [...] wird zur Vorbereitung des Angaloppierens aus der Hüfte heraus etwa eine Handbreit verwahrend hinter den Sattelgurt gelegt. Er begrenzt das äußere Hinterbein. Der Impuls zum Angaloppieren erfolgt durch den inneren Schenkel in Verbindung mit dem Vorschieben der inneren Hüfte […].
Sobald das Pferd zum Angaloppieren ansetzt, lässt der Reiter durch leichtes Nachgeben mit der inneren Hand den Galoppsprung heraus. [...] Die Beibehaltung der Hilfen sorgt für flüssiges Weitergaloppieren. Jeder Galoppsprung sollte fast so geritten werden, als ob neu angaloppiert würde."
Isabelle von Neumann-Cosel: In den Richtlinien heißt es, dass der äußere Schenkel zurückgelegt wird. Das ist aber gar nicht nötig. Denn wenn die innere Hüfte (ich sage lieber präziser: das innere Hüftgelenk) nach vorne geschoben wird, kommt das äußere Hüftgelenk ganz automatisch zurück, weil das Becken ein knöcherner Ring ist. Bewegt sich eine Seite, bewegt sich die andere auch. Die Formulierung in den Richtlinien führt leider zu dem häufigen Fehler, das äußere Bein bis zur Schabracke hochzuziehen.
Ich sage meinen Schüler daher lieber: Lass das Pferd an die Wand herangaloppieren, die deine äußeren Hilfen bilden. Wenn man die Fußfolge beim Angaloppieren bedenkt, ist es wichtig, dass ein Pferd eine energische Betonung der Diagonale inneres Hinterbein – äußeres Vorderbein in seinem Körper zulässt, bevor es sich mit dem inneren Vorderbein in die Schwebephase abdrückt.
Dafür ist es hilfreich, wenn sich der äußere Schenkel in der verwahrenden Position für das Pferd noch einmal bemerkbar macht nach dem Motto: Ich gebe dir Halt, du wirst nicht aus der Kurve getragen…
Und: Weil das Pferd beim Angaloppieren den Rhythmus wechseln soll, muss das zunächst mal der Reiter tun. Er macht eine Art Pferdchensprung im Becken. Damit nimmt er im Moment des Angaloppierens eine Bewegung vorweg, die er nachher nur noch passiv geschehen lässt. Das Becken lässt sich also nur noch rollen, statt die Bewegung aktiv auszuführen.
Knut Krüger: Für das Angaloppieren schlage ich je nach Ausbildungsstand des Pferds zwei Varianten vor. Am besten ist dies am Beispiel Trab-Galopp zu erklären. Das Pferd muss aus dem Trab entweder in die vordere Dreibeinstütze des Galopps oder in die hintere, um anzugaloppieren.
Kann das Pferd sich aus dem Arbeitstrab schon leicht setzen, so bereitet man das Angaloppieren durch Einfangen vor. In dem Moment, in dem das Pferd mehr Last auf die Hinterhand aufnimmt, gibt der verwahrende äußere Schenkel den Impuls und das Pferd springt ins Gleichgewicht und in die hintere Dreibeinstütze.
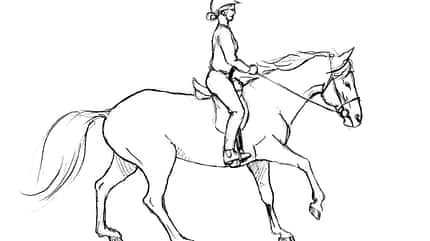
Den Impuls muss man im richtigen Ausbildungsstand von innen nach außen verlagern. Das Pferd muss das Angaloppieren vom verwahrenden Schenkel unterscheiden können. Ein kurzer Impuls des zurückgelegten äußeren Schenkels bedeutet angaloppieren, ein längerer Druck ist der verwahrende Schenkel in seiner ver-wahrenden Funktion.
Zweite Variante: Kann das Pferd seine Last nur schwer auf die Hinterhand verlagern (Remonte), so gibt der innere Schenkel den Impuls und das Pferd springt in die vordere Dreibeinstütze nach vorne.
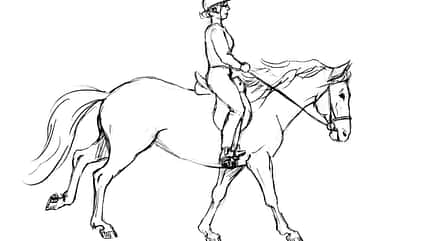
Bei Remonten kann der äußere Zügel dabei so deutlich eingesetzt werden, dass das Pferd nach außen schaut und aus Gleichgewichtsgründen dann richtig anspringt. Diese Einwirkung wird dann Stück für Stück zurückgeführt, bis man das Pferd an beiden Zügeln in den Galopp führen kann. Wenn ein Zügel leicht mehr ansteht, bleibt es der äußere. Auch aus den Richtlinien kann man herauslesen, dass beide Zügel eingesetzt werden, der äußere etwas mehr.
Die Aussage, dass der innere Zügel für Stellung in Hals und Genick sorgt, führt bei fast allen Reitern dazu, dass die Aktivität der Hinterhand deutlich reduziert wird. Ist das Pferd so geritten, dass es sich mit Hilfe des inneren Schenkels biegen lässt, benötigt man keinen kurzfristig vorherrschenden inneren Zügel. Je freier ein Pferd seinen Kopf und Hals tragen kann, desto besser sind die Lektionen.
Jeden Galoppspung wie Angaloppieren zu reiten, halte ich für wenig sinnvoll. Hilfen sollen etwas verändern.

Halbe Parade
Richtlinien: "Für einen kurzen Moment wird das Pferd durch die treibenden Schenkel- und Gewichtshilfen vermehrt bei aushaltender oder vorsichtig annehmender Zügelhilfe […] an die Reiterhand herangetrieben. Die gewünschte Reaktion des Pferdes ist […] dass es aktiver mit der Hinterhand in Richtung unter den Schwerpunkt tritt.
Durch das Zusammenwirken der Hilfen wird diese Aktivität jedoch weniger in Vorwärtsbewegung umgesetzt. Unmittelbar danach erfolgt eine nachgebende Zügelhilfe, ohne die Zügelverbindung aufzugeben. [...]"

Isabelle von Neumann-Cosel: In den Richtlinien wird die treibende Schenkel- vor der Gewichtshilfe genannt – obwohl die Gewichtshilfe generell als wichtigste Hilfe postuliert wird. Dann sollte sie meiner Ansicht nach auch vorne stehen! Die halbe Parade beginnt immer zunächst im Reiterkörper. Sie ist ein Hallo-Wach ans Pferd, aber zuvor muss sie ein Hallo-Wach in mir selbst sein. Dazu muss ich die Grundspannung der Muskulatur im Oberkörper erhöhen, in eine positive Spannung finden. Die braucht übrigens auch das Pferd, um fein darauf zu reagieren und unter meine Körperspannung zu treten. Der angedrückte Schenkel wird bei der halben Parade dagegen völlig überschätzt.
Knut Krüger: Die Beschreibung der halben Paraden in den aktuellen Richtlinien ist viel zielführender als in älteren. Trotzdem würde ich es vorziehen, den Einfluss der Hand noch weiter zurückzustellen. Unsere heutigen Pferde haben ein sehr leichtes Genick und reagieren auf zu viel Hand mit aufrollen.
Ich reite halbe Paraden mit so wenig Hand wie gerade nötig. Beim Beenden rate ich, lieber die Verbindung kurz aufzugeben, als zu wenig nachzugeben. So überprüfen Sie sogar noch kurz die Selbsthaltung des Pferds.
Die treibenden Hilfen sollten in der halben Parade überwiegen. Hier stufe ich sehr fein ab. Bei einem Vollblüter kann so wenig ausreichen, dass man es kaum als Treiben wahrnimmt. Bei diesen Pferden die Paraden mit normalen Schenkelhilfen zu geben, kann schnell in einem sehr hohen Tempo enden. Das richtige Maß erkennt man daran, das das Tempo unverändert bleibt.
Ganze Parade
Richtlinien: "Die ganze Parade […] führt immer zum Halten. Sie besteht aus einer Folge von halben Paraden. Das eigentliche Halten wird von mehreren halben Paraden vorbereitet und eingeleitet. Die letzte halbe Parade führt zum Halten […]
Es ist wichtig, dass das Leichtwerden mit der Hand im Moment des Übergangs erfolgt und nicht erst, wenn das Pferd zum Stillstand gekommen ist. So ist das Pferd in der Lage […] im Gleichgewicht zu bleiben."
Isabelle von Neumann-Cosel: Die Gewichtshilfe ist ganz wichtig, wie bei den halben Paraden. Ich erhöhe meine Oberkörperspannung und den Druck meiner Gesäßknochen. Ist das Pferd gewöhnt, dass der Reiter der Bewegung mit dem Becken locker folgt, reicht es, kurz das Becken stillzuhalten, und das Pferd steht.
Es versteht: Ich möchte jetzt auch von dir keine Bewegung mehr. Dann muss der Brustkorb des Reiters dem Pferd sagen: Bleib mit deinem Körpergewicht genau hier. Der Reiter darf auf keinen Fall hinter die Bewegung kommen – dann kann das schön beschriebene Leichtwerden mit der Hand im Moment des Übergangs gelingen.
Knut Krüger: Die ganze Parade vermittle ich genauso wie Übergänge in eine niedrigere Gangart oder das Einfangen des Tempos. Dazu ist die Gewichtshilfe entscheidend. Ich beschreibe sie so: In den schwunghaften Gangarten versucht der Reiter in dem Moment, in dem das Pferd den Rücken beginnt nach oben zu bewegen, mit aufrechtem Sitz etwas mehr Druck auf den Rücken auszuüben als beim vorherigen Takt.
Beim Aussitzen versucht der Reiter das Mitfedern (durch Kippen des Beckens nach hinten) minimal später einzuleiten, im Leichttraben kann man sich dazu minimal später hochwerfen lassen. Man kann es auch als länger sitzen bezeichnen. Vermittelt wurde mir das von Waldemar Reß.
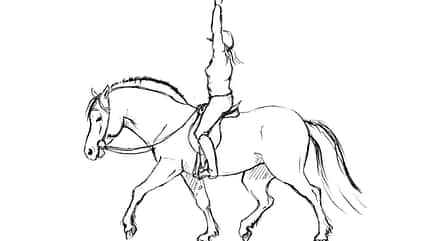
Streckt der Reiter einen Arm maximal nach oben, gibt er automatisch diese Gewichtshilfe (bei Sally Swift beschrieben). Kennt das Pferd diese Art der Hilfengebung noch nicht und reagiert innerhalb einer Pferdelänge auf den vermehrten Druck im Sattel nicht, fangen Sie es mit dem Zügel ab – so vermitteln Sie ihm nach und nach diese Hilfe.
Als zweiten Schritt erarbeitet man mit dem Pferd den Übergang Trab-Schritt folgendermaßen: Aus einem Arbeitstrab fängt man das Pferd mit einer ersten Gewichtshilfe ein. Sobald das Pferd reagiert, gibt man sofort eine weitere gleichartige Hilfe. Auf diese soll das Pferd durchparieren. Im gleichen Zweischritt lässt sich auch aus dem Schritt anhalten – fertig ist die ganze Parade. Den Unterschied macht die Länge der Gewichtshilfe.
Biegen
Richtlinien: "Unter Biegung (Längsbiegung) wird eine Krümmung der Längsachse des Pferdes verstanden […] Die Biegung wird durch konsequente Abstimmung der ,diagonalen Hilfenʻ erreicht.
Der innere Gesäßknochen wird vermehrt belastet. Der innere Schenkel aktiviert am Gurt den gleichseitigen Hinterfuß und treibt das Pferd an die äußeren Zügel- und Gewichtshilfen heran. Um diesen Schenkel herum wird das Pferd gebogen. Der verwahrende äußere Schenkel liegt eine Handbreit hinter dem Gurt und sorgt dafür, dass Vor- und Hinterhand auf einer Hufschlaglinie bleiben.
Der innere Zügel sorgt für eine leichte Stellung und führt – wenn erforderlich – das Pferd in die Wendung hinein. Der äußere Zügel gibt so viel nach, wie es die Stellung oder Biegung des Pferdes nach innen erfordert […]."

Isabelle von Neumann-Cosel: Die Biegung dient der Geraderichtung des Pferds. Doch dieser Begriff wird meiner Ansicht nach viel zu zweidimensional gedacht. Auf Zeichnungen sieht man stets das Pferd von oben, gebogen wie eine Banane. Dabei vergisst man, dass sich das Pferd auch in seiner Höhe der gebogenen Linie anpassen muss, statt sich wie ein Motorrad in die Kurve zu legen.
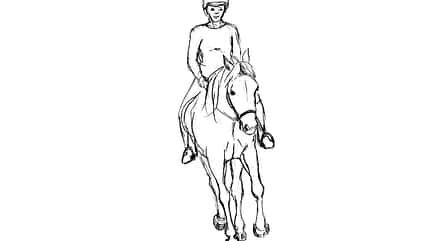
Das wird immer wichtiger, da die heutigen Pferde deutlich schmaler und höher sind als die Pferde früher. Das Pferd muss also ,aufrecht‘ durch die Kurve gehen, und dazu müssen die Muskelketten in seiner Körperaußenseite vermehrt arbeiten.
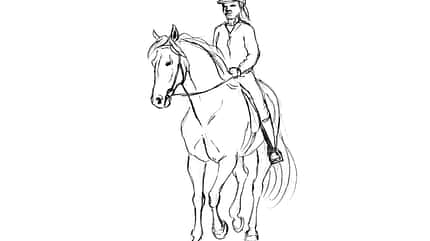
Ich empfehle daher meinen Schülern, beim Reiten von gebogenen Linien das Pferd mit ihren Hilfen nicht einfach wie eine flache Banane um den Schenkel biegen zu wollen. Vielmehr sollen sie dem Pferd zeigen, wie es sich ausbalancieren kann. Das muss in beide Richtungen gelingen: von innen nach außen und von außen nach innen.
Das funktioniert zum Beispiel, indem man das Pferd schenkelweichenartig nach außen bewegt; nach innen geht es schulterhereinartig. So kann der Reiter durch seine Einwirkung auf das seitliche Kippen oder Lehnen des Pferds Einfluss nehmen und es am Ende in seinem gesamten Körper geraderichten, statt nur die Wirbelsäulse in Längsrichtung biegen zu wollen.
Friedhelm Petry: Dafür, dass Vor- und Hinterhand auf einer Hufschlaglinie bleiben, sorgt in der Biegung der äußere Schenkel auch laut Richtlinien. Meiner Ansicht nach muss er aber mehr tun, als nur herumliegen. Er muss weit genug vorne bleiben, damit er auch das äußere Hinterbein vortreiben kann.
Liegt der Schenkel am Rippenbogen zu weit hinten, kann es sein, dass empfindliche Pferde unwillig oder kitzelig reagieren. Dann rate ich, das äußere Bein auch mal etwas weniger weit als eine Handbreit wie laut Richtlinien zurückzulegen. Der äußere Zügel muss außerdem stets im Vordergrund bleiben.
Knut Krüger: Zu fast 100 Prozent müssen Reitschüler erst einmal lernen, mit beiden Zügeln gleich viel Kontakt aufzunehmen, ohne dass sie das Pferd durch einseitige Zügeleinwirkung aus dem Gleichgewicht bringen. Meist ist der innere Zügel zu stark, wenn das Abwenden nicht klappt. Die diagonale Hilfengebung und das Stellen sollte deshalb aus meiner Sicht nicht als praktische Anweisung, sondern als Ergebnis des korrekt ausgebildeten Pferdes erklärt werden.
Schulterherein
Richtlinien: "Der innere Gesäßknochen wird vermehrt belastet. Der innere Schenkel liegt am Gurt, treibt das Pferd an den äußeren Zügel heran (diagonale Hilfengebung), sorgt für die Rippenbiegung und veranlasst den inneren Hinterfuß zum Vortreten in Richtung zwischen die pur der beiden Vorderhufe. Der äußere Schenkel liegt in verwahrender Position und verhindert ein Ausweichen der Hinterhand. Er ist auch treibend für die Vorwärtsbewegung mit verantwortlich. Der innere Zügel [...] ist in Verbindung mit dem inneren Schenkel für eine etwas deutlichere Längsbiegung verantwortlich [als beim Schultervor]. Der äußere verwahrende Zügel gibt etwas nach. [...] Er begrenzt [...] die Stellung. Besonders wichtig ist, dass der Reiter im Gleichgewicht sitzt. Er blickt weit über die Pferdeohren [...] in die Richtung, in die das Pferd gestellt ist."
Friedhelm Petry: Schulterherein ist sehr anspruchsvoll. Häufig laufen die Pferde über die äußere Schulter weg. Dem kann man entgegenwirken, indem man den inneren, stellunggebenden Zügel ganz klar auf Höhe der äußeren Hand nach innen vom Pferdehals wegführt. Der Zügel darf dabei nicht rückwärtswirken, sonst überstellt man den Pferdehals. Die innere Hand geht nämlich sowieso schon leicht zurück, weil sich der Reiter beim Schulterherein im Oberkörper leicht nach innen dreht. Alles Weitere wäre zu viel.

Knut Krüger: Um das Schulterherein zu üben, empfehle ich, eine Volte in der Mitte der Bahn zu reiten und immer dann, wenn die Biegung bestmöglich ist, mit dem vorwärts/seitwärts-treibenden inneren Schenkel zu treiben und die Vorwärtsbewegung kurz mit der Hand abzufangen. Die Gerade, auf der man dann reitet, ist die Tangente der Volte an dem Punkt, an dem man das Schulterherein eingeleitet hat. Das Ende dieser Linie visiert man an und versucht darauf hinzureiten.
Rückwärtsrichten
Richtlinien: "[...]Durch eine Kippbewegung des Beckens nach hinten wird mit einer beidseitig belastenden Gewichtshilfe vorsichtig ein Vorwärtsimpuls gegeben, ohne den Pferderücken jedoch stärker zu belasten. (Der Oberkörper bleibt aufrecht.) Die Unterschenkel des Reiters wirken gleichzeitig vorwärtstreibend, um ein aktives Anheben und danach Zurücktreten der Beine zu veranlassen.
Beide Zügel wirken für einen kurzen Moment aushaltend bzw. leicht annehmend und sofort anschließend nachgebend. Die durch die treibende Einwirkung abfußenden Beinpaare treten so nach hinten, der Bewegungsimpuls wird nach rückwärts umgeleitet. [...]"

Isabelle von Neumann-Cosel: Bei jungen Pferden variiere ich die Gewichtshilfe gerne etwas. Statt einer beidseitig belastenden Gewichtshilfe entlaste ich leicht. Die Gesäßknochen gehen etwas weg vom Sattel. Da Rückwärtsrichten stark versammelt und das Pferd den Rücken aufwölben muss, fällt es jungen Pferden mit entlastendem Sitz leichter.
Später, beim weiter ausgebildeten Pferd, bleibt man dann wirklich aufrecht, behält aber eine leichte Spannung mit dem Brustbein nach vorne im Oberkörper. Zum Anhalten aus dem Rückwärts gehe ich dann mit dem Oberkörper minimal zurück, erhöhe die Grundspannung und sage dem Pferd so: Bitte hier unter mir anhalten.
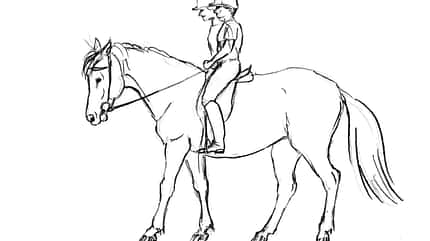
Friedhelm Petry: Ich habe die Hilfengebung beim Rückwärtsrichten noch etwas anders gelernt als in den Richtlinien beschrieben. Zum Anhalten vor dem Rückwärtsrichten wirken Sitz, Schenkel und Hand zusammen.
Fürs Rückwärts kommt dann der Oberkörper unsichtbar etwas nach vorne, die Hand ist leicht geschlossen oder eingedreht, und die Wade wird etwas gelöst! Das Lösen der Wade bedeutet fürs Pferd: Der Weg nach hinten ist offen. Der Weg nach vorne ist gleichzeitig durch die Hand verschlossen. Die Hand darf dabei nicht zu stark einwirken, eine Rahmenerweiterung im Rückwärts ist das Ziel.
Knut Krüger: Treiben während des Rückwärtstretens empfinden die meisten Pferde eher als unverständlich, denn Treiben bedeutet aus dem Rückwärtsrichten Halten oder Vorwärtsgehen. Man treibt nach dem Anhalten nur, bis das Pferd rückwärts antritt. Durch die stehenbleibende Hand wissen damit vertraute Pferde, dass Rückwärts gefordert wird.
Eine gute Hilfe, um das Tempo im Rückwärtsrichten zu steigern: kurzes, taktmäßiges Eindrehen der Hände im Moment des Abfußens des diagonalen Beinpaares und sofortiges Nachgeben, bevor das Bein wieder den Boden berührt. Wie in den Richtlinien beschrieben, bleibe ich im Oberkörper gerade. Vorgehen finde ich kontraproduktiv, denn das Pferd müsste erst wieder das neue Gleichgewicht finden.
Schenkelweichen
Richtlinien: "Schenkelweichen wird mit Stellung, aber ohne Biegung geritten […]. Der Reiter [...] bewegt sein Becken etwas nach vorne-innen, also zu der Seite, in die das Pferd gestellt ist, um den inneren Gesäßknochen vermehrt zu belasten […] Der innere Schenkel liegt [vorwärts-seitwärtstreibend] knapp hinter dem Gurt und treibt im Rhythmus des abfußenden Hinterbeins. Der äußere Schenkel liegt verwahrend hinter dem Gurt […]. Der verwahrende äußere Zügel lässt die Stellung zu, verhindert jedoch ein zu starkes Abstellen im Hals sowie ein daraus resultierendes Ausweichen über die Schulter."

Isabelle von Neumann-Cosel: Beim Schenkelweichen sehe ich die Gefahr, dass man in der inneren Hüfte einknickt, weil man zu stark mit dem inneren Schenkel drücken will. Darum würde ich die Hilfengebung so erklären: Seine innere Seite macht der Reiter wirklich lang, der Brustkorb bleibt genau überdem Becken.
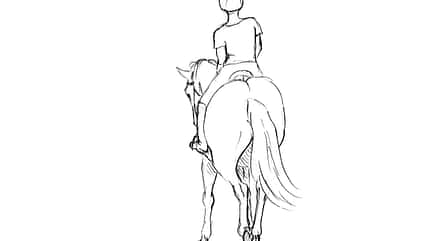
Nun soll der Reiter sich vorstellen, das Pferd mit seiner ganzen, langen inneren Seite nach außen zu schieben. Manche untrainierten Pferde haben Angst, ihr Gewicht auf ihre Körperaußenseite zu verlegen, weil sie nicht wissen, ob sie die Balance halten können.
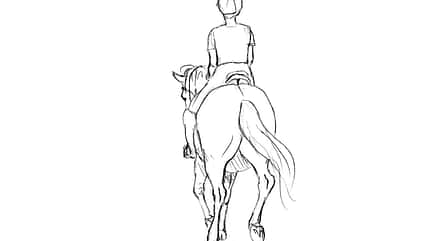
Bei ihnen wirkt dieses innere Bild des Reiters für die Hilfengebung besonders gut. Betont man den Schenkeldruck zu stark, führt das in diesen Fällen nämlich nur zu Gegendruck, weil sich das Pferd umgeworfen fühlt.
Friedhelm Petry: In den Richtlinien heißt es: Schenkelweichen wird mit Stellung, aber ohne Biegung geritten. Ich lasse das Schenkelweichen aber gerne ohne Stellung reiten. Der Effekt ist genau der gleiche, und der Reiter hat dann weniger das Bedürfnis, etwas am inneren Zügel zu machen und diesen vorherrschen zu lassen.
Dadurch laufen auch viele Pferde über die äußere Schulter davon. Stattdessen lasse ich den Reiter Genick und Hals des Pferds ganz gerade halten. Um das Vorwärts im Vorwärts-Seitwärts nicht zu verlieren, kann man außerdem den inneren Schenkel bewusst vorne lassen.
Denn inneren Gesäßknochen würde ich beim Schenkelweichen nicht bewusst mehr belasten. Der Reiter sollte gleichmäßig mittig sitzenbleiben, tendenziell sogar etwas mehr nach außen sitzen. Denn wenn man mit dem inneren Schenkel treibt, bringt man ohnehin automatisch mehr Gewicht nach innen.
Außerdem kann man das Schenkelweichen auch variieren, indem man dabei Biegung vom Pferd erfragt. Dabei tritt der äußere Zügel mehr in den Hintergrund und muss nachgeben. Dann wird die äußere Schulter des Pferds weniger gebremst und der innere Zügel führt das Pferd in die Biegung.
Knut Krüger: Mir ist es unverständlich, wie ich überhaupt ein Pferd im Genick stellen soll, ohne dass der Hals eine Längsbiegung mitmacht. Die Richtlinien verlangen das, schweigen sich übers ,Wie‘ aber aus. Das Pferd bleibt daher bei mir beim Schenkelweichen in sich gerade.
Für Schenkelweichen mit dem Kopf zur Bande lasse ich statt nach der Ecke wie in den Richtlinien lieber bereits vor der Ecke beginnen: Man wendet vor der Ecke ab, um schräg mit geradem Pferd auf die Bande zuzureiten. Um dagegen mit dem Kopf zur Bahn Schenkelweichen zu reiten, wendet man ab und macht das Pferd gerade (kurz geradeaus reiten). Man startet also immer mit einem geraden Pferd.
Das Becken lasse ich meine Schüler nicht bewusst innen nach vorne bringen, sondern das äußere Knie so weit zurückbewegen, bis das Gewicht von allein auf den inneren Gesäßknochen wandert. Das führt zu einem geraden Sitz im Gleichgewicht. Dann treibt der innere Schenkel gerade so stark, dass eine Reaktion erfolgt und hört auf, wenn das Pferd seitwärts geht. Danach wird nur noch korrigierend getrieben, sollte das Pferd die Lektion beenden oder weniger gut ausführen.





