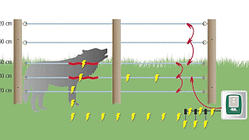Affenhitze und kein Regen: 2018 ist der Rekord-Dürresommer in Deutschland. Auf Weiden wächst kaum Gras oder es verdorrt in der Hitze. Die Pferde von Diplombiologin Dr. Eva Küppers und CAVALLO-Redakteurin Nadine Szymanski werden artgerecht gehalten. Sie stehen in einem Stall nahe Stuttgart, dessen Koppeln keinen Tag geschlossen sind.
Mitte Juli holt eine Einstellerin ihr Pferd morgens von der Weide und wundert sich, dass die Stute stark speichelt. Ein paar Stunden später liegt das Tier in der Box. Die Tierärztin behandelt akute Vergiftungssymptome und muss den Kreislauf stabilisieren. Bis zum Abend bangt die Einstellerin um ihr Pferd. Eine andere Stute aus der gleichen Gruppe zeigt die gleichen Symptome und wird ebenfalls behandelt.
Seltsame Symptome ohne klare Ursache
Hatten die Stuten etwas Giftiges gefressen? Die betroffene Koppel wird vorerst gesperrt. Doch das starke Speicheln tritt auch bei weiteren Pferden auf, die auf anderen Weiden stehen. Auffallend viele Tiere laufen fühlig, manche haben stark angelaufene Beine, sind ungewöhnlich unrittig, wirken müde und lustlos oder lahmen mit unklarer Ursache. Hin und wieder gibt es leichte bis mittelschwere Koliken. Ohne Koppelgang bessern sich die Symptome, teilweise von einem Tag auf den anderen. Dr. Eva Küppers und Nadine Szymanski forschen nach: Was wächst auf der Wiese?
Giftpflanzen sind es nicht. Alle Koppeln werden gründlich und mehrfach abgesucht. Bei ihren Recherchen nach Krankheiten, die mit dem Weidegang in Verbindung stehen könnten, werden die beiden schnell fündig: Unter den Namen "Grass Sickness", "Schwingelödem", "Rye grass staggers", "Equine Fescue toxicosis" oder dem "Slobber Syndrom" finden sie Symptome, die sie bei ihren Pferden beobachtet haben.
Bis auf das "Slobber Syndrom", das durch Slaframin ausgelöst wird (ein Toxin, das von dem in Klee wohnenden Pilz Rhizoctonia leguminicola produziert wird), könnten alle diese Symptome auf Gifte zurückgeführt werden, die tatsächlich nichts mit bekannten Giftpflanzen zu tun haben, sondern mit Weidegräsern. Und diese Gifte werden nicht vom Gras selbst produziert, sondern von seinen Mitbewohnern: den Endophyten.
Pilze schützen die Pflanze bei Stress mit Gift
Das Wort "Endophyt" kommt aus dem Griechischen und setzt sich zusammen aus "endo" (=innen) und "phyton" (= Pflanze). Endophyten wohnen tatsächlich in der Pflanze. Es sind sehr häufig und natürlich vorkommende symbiotische Pilze, die von außen nicht sichtbar und in den meisten Fällen völlig harmlos sind.
Doch eine Gattung dieser Pilze kann unter besonderen Voraussetzungen für Weidetiere gefährlich werden: die Vertreter der Epichloë. Sie gehören zu den Mutterkornpilzverwandten – nicht zu verwechseln mit Mutterkorn, das vor allem Futtergetreide befällt und leicht als schwarzer Besatz an den Ähren zu erkennen ist.
Die Epichloë-Pilze haben für die Pflanze wichtige Jobs: Sie helfen ihr zu wachsen und machen sie widerstandsfähiger. Gerät die Pflanze in Stress, zum Beispiel durch Dürre oder Überweidung, produzieren die Pilze Substanzen, um sie zu schützen. Diese Substanzen können jedoch für Fraßfeinde wie Weidetiere oder Insekten giftig sein. Pflanzen, in denen Epichloë-Pilze schlummern, sind also nicht immer automatisch giftig, sondern nur bei bestimmten, extremen Bedingungen – und nicht für jedes Tier.
Die Pilze der Gattung Epichloë können vier Gifte produzieren: Ergotalkaloide (mit Ergovalin als wichtigstem Vertreter) und Indolditerpene (mit Lolitrem B als wichtigstem Vertreter) sind beide für Weidetiere gefährlich. Peramine und Aminopyrrolizidine sind Substanzen, die giftig für Insekten sind.
Massive Symptome bei Weidetieren
In den USA und in Neuseeland stellen Endophyten-Toxine bereits ein großes Problem dar und sind von immenser wirtschaftlicher Bedeutung. Dort werden bei Rindern und Schafen Erkrankungen beobachtet, die damit zusammenhängen, dass die Tiere bestimmte Grasarten gefressen haben: Rohrschwingel und Welsches Weidelgras. Diese Gräser kommen in den USA und in Neuseeland hauptsächlich als Monokulturen vor.
Die Symptome der Weidetiere sind massiv: Sie taumeln, haben erhöhte Körpertemperatur und speicheln stark. Ihre Ohren, Schwänze und Extremitäten sind minderdurchblutet. Zum Teil führt dies dazu, dass sich die Huflederhaut entzündet, was zum Ausschuhen (Verlust der Hornkapsel) führen kann. Außerdem ist die Fruchtbarkeit der Tiere stark reduziert und häufig treten Fehlgeburten auf. Viele Tiere sterben.
Erste Forschungsergebnisse weisen auf eine mögliche Ursache hin: Die Symptome könnten auf Ergovalin und Lolitrem B zurückzuführen sein. Diese Gifte werden von bestimmten Vertretern der Gattung Epichloë produziert, die im Welschen Weidelgras und im Rohrschwingel vorkommen. Obwohl bisher kaum Untersuchungen existieren, wie sich die Gifte auf Pferde auswirken, gibt es Hinweise, dass sie darauf sensibler reagieren als andere Weidetiere.
Ergovalin löst Studien zufolge bei Stuten unter anderem Fehlgeburten aus und führt dazu, dass sich Blutgefäße verengen. Gelangt nicht mehr genug Blut in die Beine und Hufe der Tiere, können Gliedmaßen komplett absterben. Dies wird vor allem bei Rindern und Schafen beobachtet. Bei Pferden könnte es zu Fühligkeit bis hin zur Hufrehe kommen.
Lolitrem B ist ein Nervengift, das sowohl das zentrale als auch das periphere Nervensystem beeinflusst. Die Symptome bei Pferden können mild ausfallen, aber auch sehr ernst werden. Beobachtet werden leichtes Muskelzittern bis hin zum Muskelkrampf mit Kollaps, angelaufene Beine, Ödeme (Wassereinlagerungen) am Kopf und am Körper, Ataxie (Koordinationsstörungen), Ausfluss aus den Nüstern, starker Speichelfluss, erhöhte Leberwerte sowie Koliken und Kotwasser.
In welchen Gräsern die Epichloë-Pilze stecken
Amerikanische Wissenschaftler finden Epichloë vor allem im "perennial ryegrass" (Welsches Weidelgras bzw. Lolium multiflorum), aber auch im "tall fescue" (Rohrschwingel bzw. Festuca arundinacea). Sie können nicht nur die Pilze selbst nachweisen, sondern auch die Gifte Ergovalin und Lolitrem B.
Sie stellen fest: Die Giftmenge variiert von Jahr zu Jahr, von Region zu Region und ist abhängig von Umweltbedingungen wie Niederschlag oder Temperatur. Das zeigt unter anderem eine Studie von Forschern der Oregon State University, die 2016 veröffentlicht wurde.
Die höchsten Konzentrationen werden gemessen, wenn das Gras unter Stress wächst: Zum Beispiel also bei großer Hitze, Dürre oder wenn es stark verbissen wird – also all das, was 2018 das Problem auf etlichen Weiden war. Welsches Weidelgras und Rohrschwingel sind also in besonders hohem Maß mit Epichloë-Pilzen infiziert.
Das Problem: In Neuseeland, Australien und in den USA werden diese Gras-Arten gerne als Wirtschaftsgräser auf Weiden eingesetzt. Das Saatgut wird teils gezielt mit Epichloë infiziert, um eine besonders robuste, verbissfeste und trittgeschütze Grasnarbe zu erhalten. Inzwischen soll jedoch eine Version des Pilzes gezüchtet werden, der keine für Weidetiere toxischen Substanzen mehr produziert.
In Deutschland machen die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deuschland e. V. (VFD) und Diplom-Biologin Dr. Renate Vanselow, die kürzlich ein Buch zum Thema veröffentlicht hat ("Pferd und Grasland"), auf die Endophyten-Problematik aufmerksam.
Die Biologen Prof. Jochen Krauss und Veronika Vikuk von der Universität Würzburg haben 2019 eine Studie durchgeführt, die das Vergiftungspotenzial auf deutschen Weiden untersucht hat. Sie prüften über 3.000 Pflanzen von 13 Grassarten aus drei Regionen (Schorfheide in Brandenburg, Hainich- Nationalpark in Thüringen, Schwäbische Alb in Baden-Württemberg).
In fünf Grasarten wurden Epichloë-Pilze gefunden. Überraschend: Das Deutsche Weidelgras (Lolium perenne) war nur zu 15 Prozent betroffen, der Wiesenschwingel (Festuca pratensis) aber zu 81 Prozent. Aber auch in anderen, wild vorkommenden Schwingel-Arten wurden die Pilze gefunden. Doch diese Ergebnisse sind nicht in Stein gemeißelt. Einer der Faktoren, die eine Weide verändern können: die Nachsaat.
Was auf deutschen Weiden ausgesät wird
Vor allem in diesem Frühjahr müssen viele Pferdekoppeln nachgesät werden, um die durch den milden und nassen Winter zerstörte Grasnarbe wieder aufzufüllen. Können Pferdehalter sich darauf verlassen, dass marktübliche Mischungen speziell für Pferde- weiden geprüft und unbedenklich sind?
Die Produktvielfalt von Saatgut für Pferdeweiden ist groß – ebenso wie der Anteil an Deutschem Weidelgras (DWG) und Schwingelgräsern. Beispiel DWG: Es gilt als besonders robust und trittfest und wird deshalb häufig beigemischt. Einige Firmen verringern den Anteil zugunsten energieärmerer Gräserarten. So auch die Firma AGROBS, die nicht nur aus diesem Grund komplett auf Deutsches Weidelgras verzichtet: "Seit geraumer Zeit sind auch Epichloë-Pilze ein Thema", merkt der Hersteller auf die CAVALLO-Nachfrage zur Herkunft und Zusammensetzung seiner Saaten von sich aus an.
Andere Hersteller fügen den Saat-Mischungen für Pferdeweiden einen hohen Anteil an DWG bei. Das Produkt "PremiumSaat Derby Nachsaat" von AGRAVIS, erhältlich in Raiffeisenmärkten, besteht sogar komplett aus DWG, 25 Prozent davon gehören zum Rasentyp. AGRAVIS bestätigt CAVALLO, dass dieser DWG-Typ als Rasensorte zu- gelassen ist. Das Bundessortenamt, das Pflanzensorten schützt und die Züchtung überwacht, schreibt jedoch: "Als Rasensorten werden solche Gräsersorten bezeichnet, die (...) mit der Auflage ‚nicht zur Nutzung als Futterpflanze bestimmt‘ zugelassen sind." Dieses Verbot hat einen Grund, bestätigen die Biologen Prof. Jochen Krauss und Veronika Vikuk: "Rasensaatgut ist für Sportplätze, Golfplätze, Flugplätze oder sonstige Grünflächen, aber nicht für die Weidetierhaltung gedacht."
Und wo kommt das Saatgut her? CAVALLO hat die Hersteller gefragt. AGROBS bezieht es aus Deutschland und Belgien. Die BayWa produziert in Deutschland und bestellt einen kleinen Teil aus dem europäischen Ausland. AGRAVIS antwortet: "Einzelne bewährte Gräser werden von internationalen Züchterhäusern, beispielsweise aus USA, Kanada oder Neuseeland bezogen."
Was dies für Weiden in Deutschland bedeutet
"Problematisch wird es erst dann, wenn wir auf Monokulturen einzelner Grasarten setzen, eventuell auch mit fortschreitender Klimaerwärmung", erklären die Würzburger Biologen Prof. Jochen Krauss und Veronika Vikuk. "In Monokulturen können sich Epichloë-infizierte Gräser besser ausbreiten, da die Konkurrenz schwächer ist. Durch den Klimawandel könnten sie dadurch im Vorteil sein. Außerdem gibt es Hinweise, dass die Alkaloid-Konzentrationen in den infizierten Gräsern mit zunehmender Temperatur ansteigen. In Monokulturen ist eine Vergiftungsgefahr höher als in artenreichen Wiesen, in denen sich die Giftstoffe quasi verdünnen können. Ein weiteres Problem könnte das Aussäen von neuem infiziertem Saatgut sein, das mit Epichloë-Pilzen infiziert ist."
Die Wissenschaftler raten deshalb, Saatgut aus Europa zu kaufen. Wird ausländisches Saatgut vor der Zulassung auf Endophyten geprüft? Antwort vom Bundessortenamt: Eine Untersuchung des Saatgutes im Sortenzulassungsverfahren erfolge nicht. "Wir persönlich halten es für sinnvoll, Weidelgräser und Schwingelarten im Saatgut auf Epichloë zu testen", sagen die Biologen.
Pferdehalter können Saatgut zum Testen einschicken. Bislang ist das aber nur beim Endophyte Service Laboratory in Corvallis/Oregon (http://oregonstate.edu/endophyte-lab/) möglich. Einfacher ist es, das Gras auf Ergotalkaloide prüfen zu lassen. Das haben auch Dr. Eva Küppers und Nadine Szymanski getan. Sie schickten Proben von der Problem-Koppel an das Labor BioCheck in Leipzig. Gefunden wurde eine Ergotalkaloid-Konzentration von fast 300 ppb (parts per billion, Maßeinheit für anteilige Gehaltsgrößen). Nach der Studie der Oregon State University liegt die für Pferde gesundheitsschädliche Konzentration zwischen 300 und 500 ppb.
Hier können Sie neuste Studien und den Ratgeber des VFD runterladen:
Studie: "Infection Rates and Alkaloid Patterns of Different Grass Species Epichloe Endophytes":
Studie: "Endophyte Toxins in Grass an other Feed Feed Sources":
Die Broschüre "Pferd und Heu" wird von der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V. (VFD) herausgegeben und soll Pferdehaltern und Heuproduzenten als Handbuch dienen: